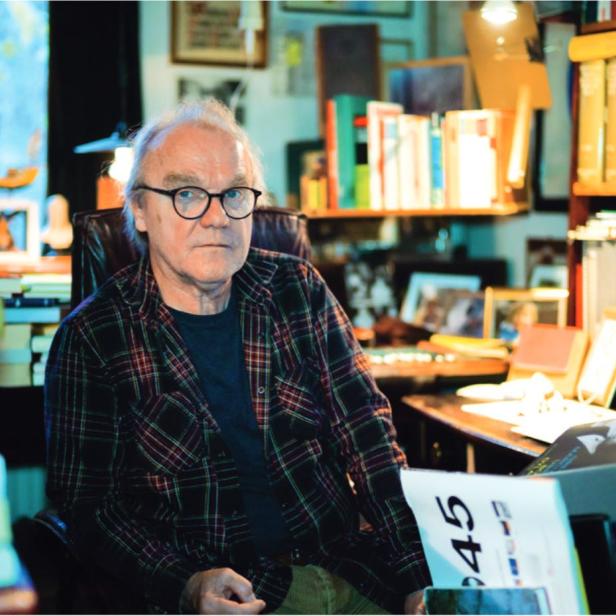Alles in Schwebe: Über ein Jahr, in dem wir lernen mussten, mit der Ungewissheit zu leben
Wie können wir, wenn alles unklar wird, überhaupt weitermachen? Und: Worauf können wir noch vertrauen?
Auf wenig war heuer Verlass. Die lange gebuchten Ferien am Meer fielen dem Virus zum Opfer. Stattdessen entdeckten wir Stadt, Land und Berg in den engen Grenzen unserer Heimat neu. Sofern die pandemiebedingten Wechselfälle es zuließen, denn nach dem Lockdown war vor dem Lockdown. Mit den Masken ging es auch auf und ab. Erst hieß es, sie seien unnütz, inzwischen gehören sie zum fixen Repertoire des Corona-Krisenmanagements. Neue Sorgen treiben uns um: Wie geht es den Kindern? Wie schützen wir die Älteren? Welche Jobs gehen verloren? 2020 war ein Drahtseilakt-das Jahr, in dem wir uns mit dem Ungewissen arrangieren mussten.
Als Spezies liegt uns das nicht. Wir streben nach verlässlichen Routinen. Vertrautes Terrain, fester Boden ist unser liebstes Habitat. Die Pandemie ließ davon wenig übrig. Als Harvard-Professoren aus unterschiedlichen Fachrichtungen im Corona-Sommer um ihre Einsichten zur Lage gebeten wurden, kreisten diese denn auch - wenig überraschend - um "uncertainty". Ein Literaturwissenschafter der US-Eliteuni verwies auf die Erzählung "Der Bau" von Franz Kafka, die vom verzweifelten Versuch eines Tieres handelt, einen todsicheren Unterschlupf zu graben. Das Werk gelingt beinahe, braucht aber ein Loch, das als Zugang dient. Eine unvermeidliche Schwachstelle, wie das Tier erkennt: "Dort an jener Stelle im dunklen Moos bin ich sterblich." Das Loch ist Bedrohung und Lebenselixier zugleich, denn es hält wach und schärft die Sinne für unbekannte Gefahren. In einer Welt, in der nichts mehr berechenbar ist, könnten wir genauso wenig leben wie in absoluter Sicherheit.
Dass Überraschungen sowohl angenehm als auch böse ausfallen können, wussten wir schon vor der Pandemie. Das Wort bezeichnete im 17. und 18. Jahrhundert nicht nur "Erstaunen" oder "Verwunderung über Unerwartetes", sondern auch einen "feindlichen Überfall", eine "Überrumpelung". Leider sind die für einen lässig-lockeren Umgang mit Überraschungen nötigen Ressourcen ungleich verteilt. Nicht alle Menschen kommen damit gleich gut zurecht. Neurowissenschafter wiesen nach, dass die Amygdala - nach derzeitigem Stand der Bedrohungsdetektor im Gehirn - umso mehr arbeitet, je unklarer die Lage ist. Wenn das stimmt, war sie heuer im Hochbetrieb. Das Jahr der Widersprüche und unerwarteten Wendungen machte die gesamte Palette des Überraschtseins erlebbar: Man staunte und wunderte sich, fühlte sich ausgeliefert und überrumpelt.
Vor acht Jahren legte Nassim Nicholas Taleb, Bestsellerautor und Finanzstatistiker an der New York University, ein Werk mit dem spröden Titel "Anti-Fragilität" vor, dessen Untertitel es nun als Buch der Stunde empfiehlt: "Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen". Wer Zufälle und Ungewissheit um jeden Preis von sich fernzuhalten versucht, geht unter wie ein Surfer, der die Welle falsch erwischt. Oben bleibt, wem es gelingt, sie in Stärken zu verwandeln. Antifragil im Taleb'schen Sinn meint mehr, als bloß robust oder resilient genug zu sein, um einen Zusammenprall mit der Wirklichkeit unbeschadet zu überstehen und dann weiterzumachen wie bisher. Es meint Veränderung zum Besseren durch das, was uns herausfordert. Es meint ein Prinzip hinter dem Lauf der Geschichte-von der Evolution über die Entwicklung politischer Systeme bis hin zu Kochrezepten. "Alles, was von zufälligen Ereignissen oder Erschütterungen mehr profitiert, als dass es darunter leidet, ist antifragil; das Umgekehrte ist fragil", schreibt Taleb.
Das Traurige an seinem Befund ist, dass auch der Profit, von dem Taleb schreibt, ungleich verteilt ist. Während die einen gestärkt aus der Krise herausfinden, werden andere noch fragiler. Die aktuelle Pandemie gleicht in dieser Hinsicht einem Fluss, in dem die Abenteurer, Wagemutigen und Experimentierfreudigen obenauf schwimmen, während andere still und leise ertrinken. Wie viele Tote das Virus am Ende gefordert haben wird, wissen wir noch nicht, und seine heimlichen Opfer-Alleinerzieherinnen, die psychisch zusammengebrochen sind; Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und keine mehr finden; Suizide aus Verzweiflung; pleitegegangene Unternehmen; implodierte Organisationen-werden wir irgendwann sehen, aber vermutlich nie zählen können.
Wir tendieren dazu, das Unbekannte zu meiden, fühlen uns davon belästigt oder gar überwältigt. Wir spucken darauf, brüllen es nieder, machen uns darüber lustig oder negieren es wie Kinder, die sich eine Haube über das Gesicht ziehen und glauben, dass niemand mehr sie sieht. Ganz am Anfang der Pandemie wagten Forscherinnen und Forscher nicht abzuschätzen, wie schlimm die Sache werden wird. Erst im Laufe der Wochen sickerte, dass Covid-19 auch von Menschen übertragen wird, die keinerlei Symptome zeigen. Wirtschaftsauguren sagten eine V-Entwicklung vorher, einen raschen, steilen Einbruch, dem eine ebenso rasche Erholung folgen würde-und revidierten ihre Prognosen später nach unten. Regierungen ordneten an und ruderten zurück. Ihre Fehleinschätzungen verbreiteten sich-gemeinsam mit den Irrtümern der Experten-als Lachnummern auf YouTube-Kanälen.
Zweifel an der Expertise der Fachleute schlichen sich bis in die Mitte der Gesellschaft, hinterlistig angefeuert von Verschwörungsmystikern, Corona-Leugnern und politischen Profiteuren der Verunsicherung. Als die Politikwissenschafter Ivan Krastev und Mark Leonard im Sommer die Stimmung in neun EU-Ländern ausloteten, war das Vertrauen in Behörden und Experten merklich erodiert. In Deutschland hielten nur mehr 44 Prozent der Befragten große Stücke auf sie. Auch die EU war bei vielen unten durch. In Italien, das zu den ersten vom Virus getroffenen Ländern gehörte, meinten nur vier Prozent, auf die EU sei in den dunkelsten Stunden Verlass gewesen. Zum Vergleich: 25 Prozent sahen in China eine verbündete Macht.
Das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, macht Menschen seit jeher nicht nur anfällig für Misstrauen ins System, sondern auch für autoritäre Führer. Dabei können wir unser Wissen immer nur aus bekannten Phänomenen beziehen. Das Neue geht-naturgemäß-mit Überraschungen einher. Forscher haben gelernt, dem mit Versuch und Irrtum zu Leibe zu rücken. An gewisse Unschärfen ist man in der akademischen Welt gewöhnt. Selbst Physiker schworen der Ja-Nein-Logik ab, als sie in die Bereiche der kleinsten Teilchen vorstießen. Fakten sind selten unschuldig, müssen sortiert und interpretiert werden. Zwei Virologen können auch mit demselben Datenmaterial zu unterschiedlichen Schlüssen gelangen. Und bei allem Bemühen: Das Ende der Corona-Krise können sie genauso wenig ablesen wie Ökonomen die wirtschaftlichen Folgen. Wir müssen uns mit ihren vorläufigen Ansichten behelfen.
Die Empörung darüber, die Wut, die Aggression, das Witzemachen und das Verleugnen ist menschlich verständlich, aber keine schlaue Antwort, wenn es um unsere langfristige Entwicklung als Gesellschaft geht. Wie die meisten Zeitgenossinnen würde ich mich nie im Leben auf ein Seil wagen, das über einen Abgrund gespannt ist. Sogar auf wackeligen Hängebrücken mit Geländer bekomme ich weiche Knie. Trotzdem können sich auch die Höhenängstlichen unter uns von den Artisten der Bodenlosigkeit etwas abschauen. Sie haben ihre atemberaubenden Kunststücke in der Luft vorher lange in sicherem Setting trainiert und dabei gelernt, sich im Moment zu entspannen und wach zu sein, um auf jede winzige Schwankung reagieren zu können-obwohl der Ausgang offen und ein Absturz jederzeit möglich ist.